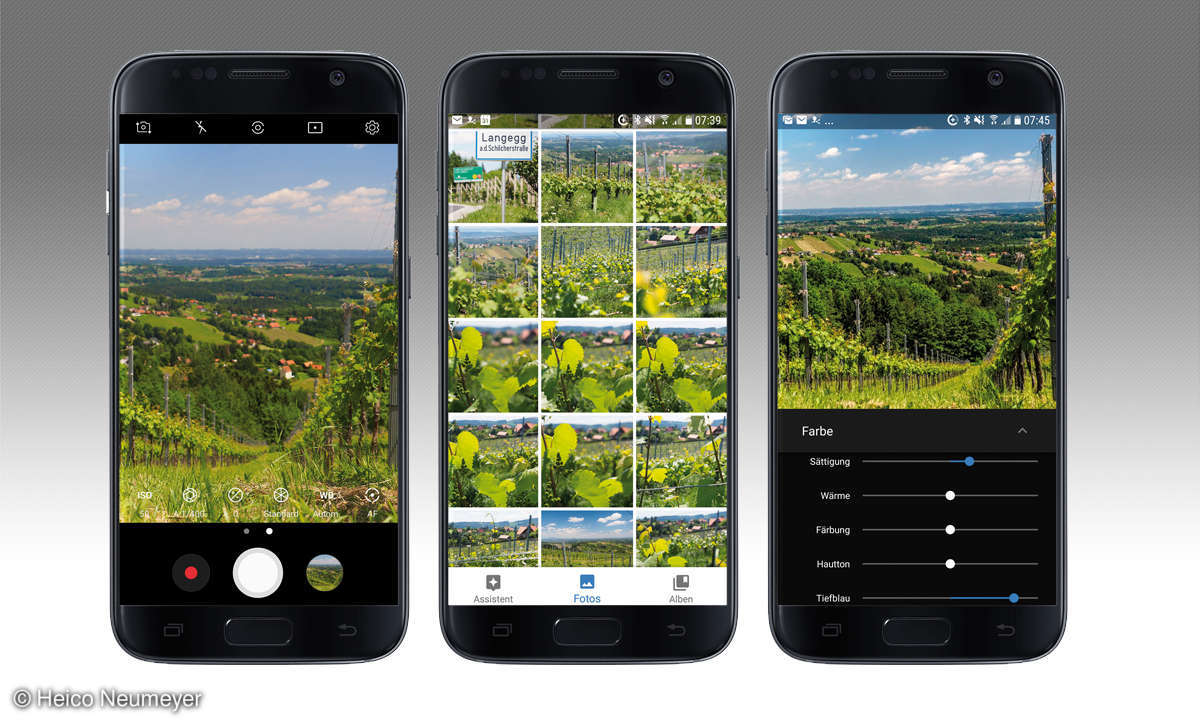Thermische und piezoelektrische Drucktechnik
- Tintenstrahltechnik
- Historie
- Thermische und piezoelektrische Drucktechnik
Am grundlegenden Prinzip des Tintenstrahldrucks hat sich genau genommen seit Jahrzehnten nichts geändert: Wie die Pioniere besitzen auch aktuelle Tintenstrahler einen Motor, der das Papier zunächst vor Druckbeginn zur Startposition und schließlich während des Drucks Zeile für Zeile weiter befö...
Am grundlegenden Prinzip des Tintenstrahldrucks hat sich genau genommen seit Jahrzehnten nichts geändert: Wie die Pioniere besitzen auch aktuelle Tintenstrahler einen Motor, der das Papier zunächst vor Druckbeginn zur Startposition und schließlich während des Drucks Zeile für Zeile weiter befördert. Ein zweiter Motor bewegt den Schlitten, der den Druckkopf und meist auch die Tintentanks horizontal über das Blatt bewegt. Auf dem Druckkopf sind viele winzige Düsen untergebracht, die mikroskopisch kleine Tintentröpfchen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 Metern pro Sekunde in Richtung Druckpapier abfeuern. Um die Tinte auf diese kurze Distanz derart zu beschleunigen, kommen zwei verschiedene Verfahren zum Einsatz: Canon und HP nutzen dazu seit jeher einen thermischen, Epson mit der Piezotechnik dagegen einen mechanischen Prozess.

Thermisches Verfahren: Jede Düse besteht aus einer mit Tinte gefüllten Düsenkammer, die über Kanäle mit den Tintentanks verbunden ist. Beim thermischen Tintenstrahldruck (Bubble-Jet) befindet sich in jeder Düsenkammer ein etwa 500 bis 1000 µm2 kleines Heizelement. Sobald hier eine elektrische Spannung angelegt wird, erhitzt dieses Heizelement die Tinte in der Düsenkammer - bis sie bei etwa 300 Grad Celsius verdampft. Die Dampfblase dehnt sich aufgrund der Wärmezufuhr immer weiter aus, bis dort der Druck hoch genug ist, um einen Tintentropfen aus der Düsenöffnung zu drücken. In diesem Moment stoppt die Wärmezufuhr, der Tintentropfen reißt ab und schießt mit hohem Tempo in Richtung Papier. Aufgrund des dadurch entstandenen Unterdrucks, füllt sich die Düsenkammer erneut mit Tinte aus dem Reservoir, und alles beginnt wieder von vorne.
Canon erzählt übrigens die nett klingende Geschichte, dass der Canon-Mitarbeiter Ichiro Endo 1977 als Erster beim Hantieren mit Lötkolben und Injektionsspritze zufällig auf das Bubble-Jet-Phänomen stieß und damit die Entwicklungslawine im Canon-Labor ins Rollen brachte. HP hat eine ähnliche Geschichte auf Lager, bei der statt Lötkolben eine Kaffeemaschine für den glücklichen Zufall verantwortlich war. Tatsache ist, dass Canon und HP parallel an der Technik arbeiteten und 1984 praktisch zeitgleich die ersten Geräte zur Marktreife brachten.

Mikropiezodruck: Das piezoelekrische Druckprinzip geht zurück auf den von Walter Lippmann 1881 postulierten inversen Piezoeffekt: Bei Anlegen einer elektrischen Spannung verformen sich piezoelektrische Materialen wie Quarzkristall, Lithiumniobat und Galliumorthophosphat. Dabei ändert der Kristall ausschließlich seine Form, er dehnt sich nicht aus. Auf die Piezodrucktechnik angewendet heißt dies: Die elektrische Spannung regt hier ein Piezoelement an, das sich dadurch verformt und auf eine Membran beziehungsweise die darunter positionierte Düsenkammer drückt. Diese Kammer ist mit Tinte gefüllt, welche durch den plötzlichen Stoß in Schwingungen gerät. Aufgrund dieser Schwingung wird zunächst ein Tröpfchen aus der Düsenöffnung gedrückt, das dann durch eine entgegengesetzte Schwingbewegung (Meniskus-Effekt) abreißt und auf das Blatt zuschießt. Die Tintenzuführung verteilt die Tinte von der Kartusche immer wieder gleichmäßig an alle Düsen beziehungsweise Druckkammern.

Für den thermischen Druck spricht der günstige Produktionsprozess, gegen ihn die Ablagerungen an der Düse aufgrund des Verdampfens der Tinte. Piezodruckköpfe sind zwar wegen ihrer vielen Einzelteile in der Herstellung deutlich kostspieliger, sollen dafür aber länger halten und die Tröpfchen in schnellerer Folge ausstoßen. Zudem sind sie in puncto Tropfenvolumen flexibler.