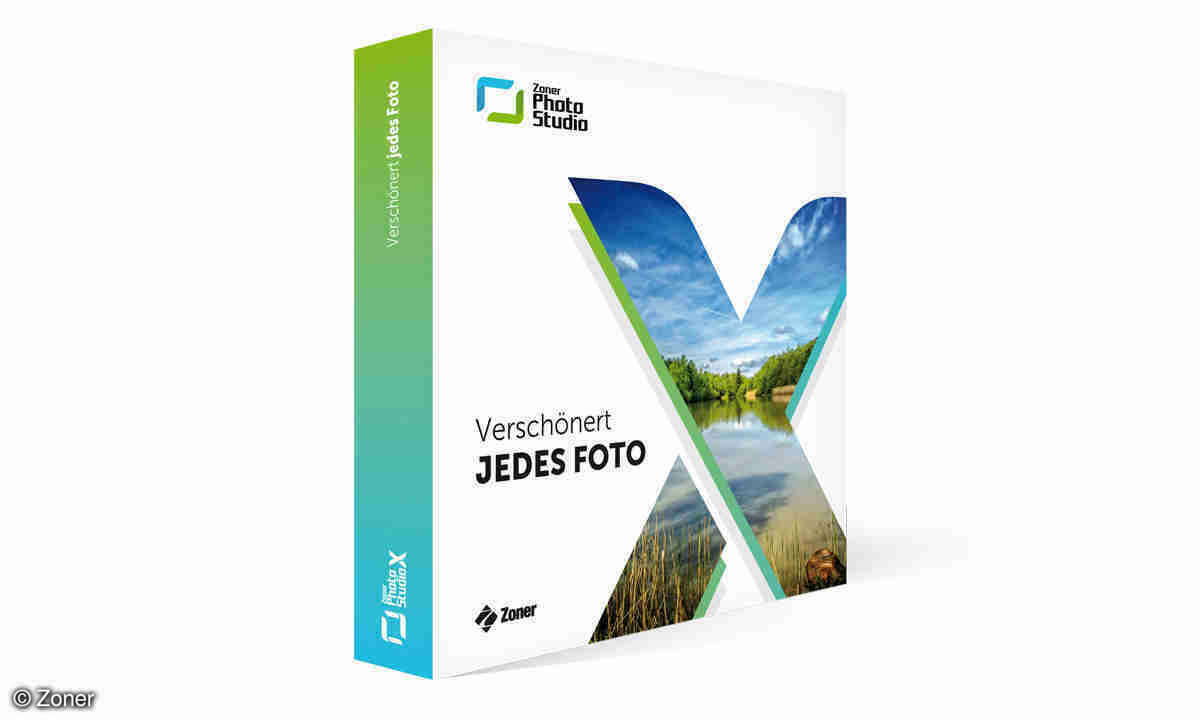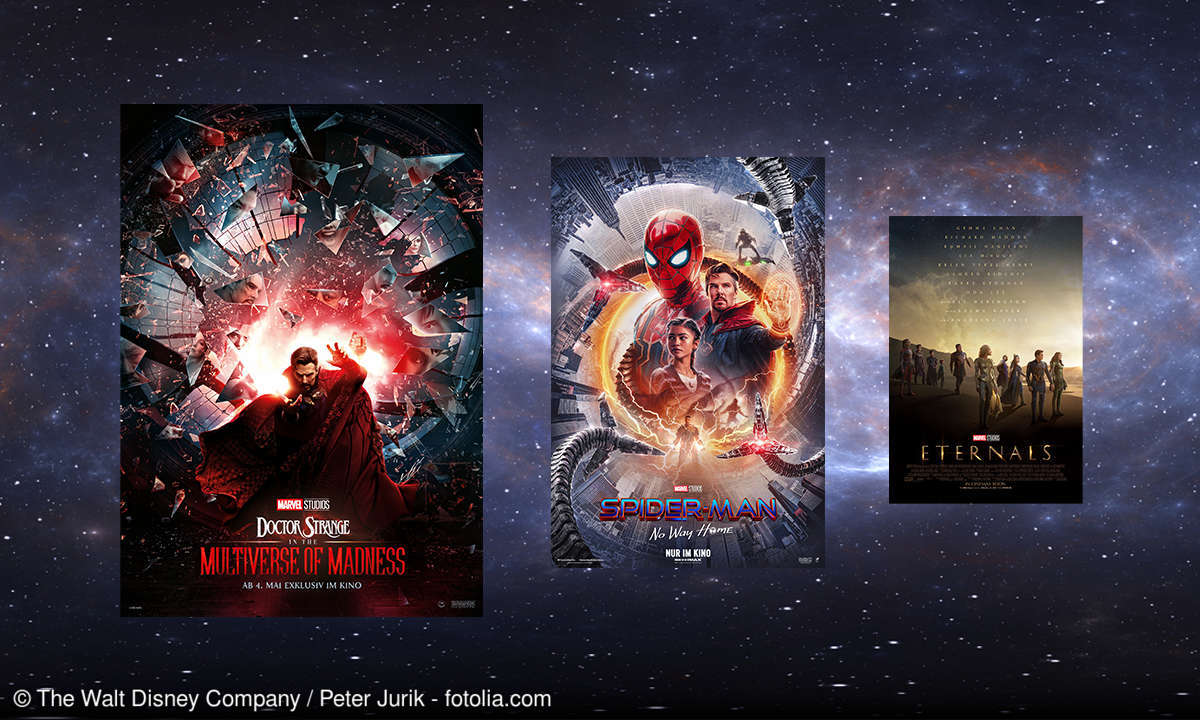Großes Kino zum kleinen Preis
Preise unter 5.000 Euro rücken das voll aufgelöste Heimkino in greifbare Nähe. Neue Panels, überarbeitete Technologien und die ersten Tests - das HomeVision-Full-HD-Beamer-Special navigiert durch die neue Auflösung.

- Großes Kino zum kleinen Preis
- Teil 2: Großes Kino zum kleinen Preis
Preise unter 5.000 Euro rücken das voll aufgelöste Heimkino in greifbare Nähe. Neue Panels, überarbeitete Technologien und die ersten Tests - das HomeVision- Full-HD-Beamer- Special navigiert durch die neue Auflösung. ...
Preise unter 5.000 Euro rücken das voll aufgelöste Heimkino in greifbare Nähe. Neue Panels, überarbeitete Technologien und die ersten Tests - das HomeVision- Full-HD-Beamer- Special navigiert durch die neue Auflösung.
Ein Kino zu Hause – für viele ein Traum, doch immer mehr wagen den Einstieg. Denn gerade der Beamer-Markt profitiert von dem Verlangen nach immer größeren Bilddiagonalen für das HD-Feuerwerk. Hundert Prozent Wachstum bei HDready- Projektoren lauten die jüngsten Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Jahre 2006. Das macht 35000 verkaufte Geräte, und für 2007 sehen die Prognosen ebenfalls rosig aus.
Als Motor sollen Geräte mit echter Full- HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln zu Einstiegspreisen im vierstelligen Bereich dienen. Denn die Projektoren auf LCoS-Basis, die JVC Professional oder Sony bereits seit Jahren führen, waren bislang unerschwinglich. Sonys Qualia 004 weckte mit seinem Erscheinen für 30.000 Euro höchstens Sehnsüchte – genauso JVCs HD2K für 24.000 Euro. Kinotaugliche Projektoren wie Sanyos PLVHD10 für 85.000 Euro gibt es sogar noch länger. Mehr als eine Hand voll dieser Geräte dürfte den Weg in die deutschen Heimkinos allerdings kaum gefunden haben. Erst der HD10K von JVC (18.000 Euro) und der "Ruby" von Sony (10.000 Euro) rückten Full-HD-Geräte in halbwegs bezahlbare Regionen.
Den großen Preisrutsch leitete Sony ein
Mit dem VPL-VW50, Codename "Pearl", unterschritt erstmals ein Projektor die magische 10.000-Euro-Grenze. Und das gleich um die Hälfte. Sagenhafte 5.000 Euro machten den Pearl zum Kassenschlager. Im vierten Quartal 2006 war jeder achte von Sony verkaufte Projektor in dieser Preisklasse angesiedelt. Trotzdem: Bedenktman, dass sich 76 Prozent des Projektorenmarktes in Preisregionen unter 1.400 Euro abspielen, müssen die Hersteller für richtige Stückzahlen noch weiter an der Preisschraube drehen.
Epsons "C2Fine"-Full-HD-LCD-Panels scheinen dafür ein Wegbereiter zu sein. Als erstes Modell mit diesem Chip unterschritt der PTAE1000E von Panasonic für 4.500 Euro den Kampfpreis von Sonys "Pearl" um 500 Euro. Der Mitsubishi HC-5000 reduzierte als zweiter Full-HD-LCD noch einmal um 500 Euro und setzt mit 4.000 Euro den momentanen Tiefpreisrekord. An dem orientiert sich auch der Epson EMP-TW1000, der in den nächsten Wochen die Konkurrenz herausfordern will. In den technischen Daten dieser "Preisbrecher" findet sich nicht nur das High-End der Paneltechnologie, sondern auch das High-End der Bildverarbeitungschips: Namhafte Hersteller wie Silicon Optix oder Gennum garantieren Präzision im Umgang mit Bildern.

Die sensationell günstigen LCD-Preise setzen die Anbieter anderer Technologien gehörig unter Druck. Allenthalben Sonys SXRDBeamer "Pearl" für 5.000 Euro hält da mit. JVCs DILA schlägt bereits mit 6.500 Euro zu Buche. Noch teurer positionieren sich die DLP-Projektoren mit Full-HD-Auflösung. Den günstigsten Einchipper liefert Optoma mit seinem HD81 für 7.000 Euro – der günstigste Dreichipper kommtmit dem HT3000 von SIM2 für satte 16.000 Euro.
Wie Texas Instruments seine DLP-Technologie in diesem preisaggressiven Umfeld platzieren möchte, erklärt Wolfram Gauglitz, BusinessDevelopmentManager von DLP, so: "Wir sind überzeugt, dass Käufer von 1080p-Projektoren sich für die beste Bildqualitätund damit für DLP entscheiden. Bei der Bildqualität sehen wir unsere klaren Stärken: hohe Kontraste, nahtlose, scharfe Bilder und der Vorteil der hohen Geschwindigkeit der DLP-Mikrospiegel. Kein Nachziehen oder Verwischen trübt das Heimkino-Erlebnis."
Auf dieser Basis haben sich etliche namhafte Hersteller wie beispielsweise BenQ, Marantz, SIM2, Projectiondesign, Planar, Sharp, Optoma und einige andere den voll auflösenden DLP-Chips verschrieben.
Zwei namhafte Projektorenschmieden lassen noch auf sich warten
Wer sich die aktuelle Full-HD-Garde anschaut, der vermisst noch den einen oder anderen namhaften Projektorenbauer. Mit Panasonic ist zwar der Marktführer bei Heimkino-Projektion dabei – Sanyo und Hitachi lassen als Zweit- und Drittplazierte aber noch auf sich warten. J. M. Jahn, Director Projector Division von Sanyo, kommentiert: "Wir werden dieses Jahr auf der IFA unsere erfolgreiche ,Z’-Serie um einen Full-HD-Heimkinoprojektor erweitern. Im Handel wird das Gerät dann direkt nach der Messe verfügbar sein. Wir planen, das Gerät aggressiver zu positionieren als alle momentan erhältlichen 1080p-Projektoren. Nur so viel sei verraten: DasGerätwird für den Endkunden deutlich unter 3.000 Euro erhältlich sein."
Axel Kutschke, Senior Manager für Präsentations- Produkte der Hitachi Digital Media Group, gibt hingegen nur einen vagen Ausblick: "Aufgrund des großen Markterfolgs der HD-Heimkinobeamer ist Full-HD sicherlich eines der nächsten großen Ziele. Angaben zur Marktverfügbarkeit künftiger Projektoren können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht machen." Der Projektorenmarktblickt also auf ein spannendes Jahr. Was es noch zu holen gibt und wie gut die ersten Vertreter sind, zeigt der anschließende Test.
TECHNIK: DLP (DIGITAL LIGHT PROCESSING)
Texas Instruments DLP-Technologie hat Epsons LCD-Panels in den letzten Jahren die technologische Marktführerschaft abgenommen. DLP-Projektoren arbeiten auf Ein-Chipoder Drei-Chip-Architektur – Letztere macht sich im Preis deutlich bemerkbar. Denn jeder Chip ("Digital Micromirror Device", kurz DMD) besteht aus abertausenden kleinen Spiegelchen (bei Full-HD sind es gar zwei Millionen). Jeder lässt sich einzeln ansteuern und in zwei Richtungen kippen. Soll Licht auf die Leinwand fallen, dann reflektieren die Spiegel in Richtung Objektiv. Soll kein Licht auf der Projektionsfläche erscheinen, dann reflektieren sie das gesamte Licht auf eine schwarze Fläche im Gehäuseinneren, welche es absorbiert. Je länger der Spiegel sich in Richtung Leinwand neigt, desto heller erscheint das entsprechende Pixel. Für Graustufen müssen die Mikrospiegel schnell hin- und hergekippt werden, was als leichtes Rauschen sichtbar wird. Während bei Drei-Chip-Lösungen ein Prisma das Licht der Projektorenlampe in seine drei Primärfarben spaltet, passiert es bei der Ein-Chip-Lösung zuerst ein Farbrad. Mit heutzutage meistens sieben Segmenten dreht das Rad mehrere tausend Mal pro Sekunde. Aufgrund dieser hohen Rotationsgeschwindigkeit des Rades nimmt das menschliche Auge die nacheinander auf die Bildwand gelangenden Farben als ganzes Farbbild wahr. Bei kritischen Bildinhalten tritt allerdings der so genannte "Regenbogeneffekt" auf. Die Ingenieure tüfteln deshalb immer neue Farbräder und Steuerprogramme aus, die diesen Effekt mindern sollen.

DIE VOR- UND NACHTEILE:
+ tiefe Schwarzwerte

+ hohe Kontraste
+ brillante Farben
- Pixelrauschen
- Regenbogeneffekt (nur Ein-Chip-Lösungen)
- sehr teuer (nur Drei-Chip-Lösungen)
TECHNIK: LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY)
Jüngst haben sich LCD-Projektoren durch die Degeneration der Panels in einigen Modellen einen ziemlich schlechten Ruf erworben. Die D6-Panel von Epson basieren deshalb auf anorganischen Materialien und sollen somit endgültig Schluss mit diesen Problemen machen.

LCD-Projektoren fürs Heimkino verfügen heutzutage allesamtüber drei Panels. Das von der Projektionslampe kommende Licht zerlegen so genannte dichroitische Spiegel (Prismen) und verteilen es zu gleichen Anteilen auf den Panels. Im Gegensatz zu DLP und LCoS muss das Licht durch die LCD-Panels hindurch. Jedes Pixel auf dem Panel fungiert deshalb als Lichtventil. Legtman eine Spannung an, richten sich die in Wendeltreppenform vorgespannten LCD-Moleküle in einer Ebene aus. Sie drehen dabei die Polarisation des einfallenden Lichts. Die vor und hinter der LCD-Schicht aufgebrachten Folien lassen ihrerseits nur in einer bestimmten Ebene polarisiertes Licht durch und komplettieren damit dasVentil. Je nach angelegter Spannung lässt es mehr oder weniger Licht passieren. Die einfarbigen Bilder jedes Panels werden dann wieder von dichroitischen Spiegeln zusammengesetzt und via ein Objektiv zur Leinwand geschickt.
DIE VOR- UND NACHTEILE:
+ flexible Projektionslösungen

+ günstigste Technologie
+ inzwischen sehr weit entwickelt (beispielsweiseschwächere Lampen und optische Blenden für bessere Schwarzwerte)
- Steuerleitungen zwischen den Pixeln zeigen Fliegengitterstruktur
- Schwarzwert schlechter als bei Konkurrenztechnologien
- Bild zeigt Schwächen in der Homogenität
TECHNIK: LCOS (LIQUID CRYSTAL ON SILICON)
Sowohl in den DILA-Projektoren von JVC (Direct- drive Image Light Amplifier) als auch in Sonys SXRD-Projektoren (Silicon X-tal (= Crystal) Reflective Display) arbeiten jeweils drei LCos-basierte Chips. Um jedes Panel mit Licht zu versorgen spaltet ein Prisma dieses als Erstes in die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau.

Zudem sitzt vor jedem Chip eine prismaähnliche Optik, welche das Licht polarisiert. Wie auf einem LCD-Panel sitzen auf jedem Bildpunkt Flüssigkristalle, welche auf aus (inaktiv) oder teildurchlässig (aktiv) geschalten werden. Aktive Pixel polarisieren das Licht erneut, je nach Spannung mehr oder weniger, und
erzeugen so mehr oder weniger Helligkeit. Das Licht trifft auf eine Spiegelfläche unter der Pixelschicht, die es dann wieder auf die prismaähnliche Optik reflektiert, welche nur das von den aktiven Pixeln polarisierte Licht zur Leinwand und das nicht-polarisierte zurück zur Lampe schickt.
DIE VOR- UND NACHTEILE:
+ sehr hohe Kontraste möglich
+ nur minimale Abstände zwischen den Pixeln
+ höchste derzeit mögliche Auflösungen
- erst seit kurzem in „erschwinglichen“ Preisregionen unter 10.000 Euro
Generationswechsel
High-End-Technologie, die noch vor wenigen Monaten im fünfstelligen Preisbereich lag, jetzt für unter 5.000 Euro. Geht das gut?

Nahezu zeitgleich lancierten Mitsubishi und Panasonic ihre Full-HD-Debütanten. Der HC-5000 von Mitsubishi unterschreitet den von Panasonic vorgelegten Preis gleich noch einmal um satte 500 Euro.
Der Herausforderer: Mitsubishi HC-5000
Letztes Jahr tat sich Mitsubishi als einer der agilsten Projektorenhersteller hervor. Nicht weniger als acht Heimkinoprojektoren umfasst das Portfolio derzeit. Der Markt belohnt das: Vom zweiten bis ins vierte Quartal 2006 konnte Mitsubishi seine Abverkäufe verdreifachen. Hierbei dürfte der Full-HD-Stern der HomeCinema-Serie HC-5000 geholfen haben, der seit Dezember 2006 in den Regalen steht.

Außergewöhnlich istdas perlweiße Gehäuse des LCD-Projektors. Während sich die Mitbewerber meist um eine möglichst dunkle Lackierung fürsHeimkino bemühen, sticht der HC-5000 damit heraus. Wer kein dezidiertes Heimkino sein Eigen nennt, freut sich über das wohnzimmerkompatible Aussehen, die sparsamen Abmessungen sowie das geringe Gewicht. Dass sich eine kompakte Form nicht negativ auf die Geräuschentwicklung auswirken muss, das beweist der HC-5000 sehr eindrucksvoll. Im Betrieb, mit oder ohne Lampensparmodus, arbeitet er flüsterleise – leiser gar als der HD-DVD-Player HD-E1 von Toshiba, welcher ein Stockwerk tiefer im Rack stand.
Clever hat Mitsubishi die Objektivabdeckung gelöst: Der vor Staub schützende Deckel haftetmagnetisch.
Bei der Aufstellung macht der HC-5000 keine Zicken. Zwei fein einstellbare Standfüße unter der Front erlauben die flexible Höheneinstellung. Die Feinjustage übernimmt der Lensshift. Mit 75 Prozent in der Vertikalen und lediglich 5 Prozent in der Horizontalen fällt dieser allerdings nicht besonders üppig aus. Der 1,6-fache Zoomfaktor ist ausreichend, hält aber mit den Testkonkurrenten nicht Schritt. Dafür lässt sich die motorisierte Optik komplett über die Fernbedienung steuern.

Die Schnittstellen- Ausstattung kann sich durchaus sehen lassen: Je ein HDMI- und ein DVI-Eingang nehmen digitale HD-Signale entgegen. Der VGA-Eingang öffnet sich für RGB-Signale vom PC – über einen optionalen Adapter auch für ein zweites Komponententrio.
Das Bedienmenü kommt im Vergleich zu den Mitbewerbern mitspartanischer Optik sowie kleinen Symbolen aus. Lobenswert hingegen ist die hervorragende Optimierung des Projektors ab Werk. Die Voreinstellungen präsentieren sich als Gamma-Modi, wobei "Kino" die erste Wahl ist. Der eigentliche Gammawert lässt sich sowohl für das Luminanzsignal als auch für die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau in drei Bereichen korrigieren. Für die Farbtemperatur trifft "Standard" die gewünschten 6500 Kelvin nahezu exakt. Der Bildbeschnitt (Overscan) lässt sich in Ein-Prozent-Schritten regeln, wobei 100 Prozent die skalierungsfreie und damit optimale Einstellung für Full-HD-Signale ist. Gutgefallen hat der Jury der so genannte "Lens Lock" – hatman das Bild erst einmal optimal auf die Leinwand gebracht, sperrtman darüber Zoom, Fokus und Lensshift, um versehentliches Verstellen der Parameter zu verhindern.

Zu guter Letztmussman sich dann noch für eine der vier Optionen zur Blendenwahl entscheiden: Drei Automodi und eine komplett offene Blende stehen zur Wahl. Leider spezifiziert das Handbuch, welches ausschließlich digital auf einer CD beiliegt, die Automatik- Modi nicht näher. HomeVision hat den Projektor in allen Blendeneinstellungen gemessen. Unsere Empfehlung lautet "AutoIris2", da dieser Modusmit 0,27 cd/m2 und mit 1100:1 ANSI-Kontrast die besten Werte auf die Leinwand bringt. Allerdings blieb die Arbeit der Blende nicht immer unsichtbar. Wechselten auf dunkle Bilder prompt helle, kam die Blende schon mal ins Schwitzen und brauchte einen Tick zu lange, um für den Zuschauer unsichtbar zu bleiben.
Für Skalierung und Deinterlacing hat sich Mitsubishi ein Schmuckstückins Boot geholt: den Reon-VX-Chip von Silicon Optix, welcher auch im High-End-Player DVD-2930 von Denon steckt. Mit der Skalierung von PAL-Inhalten geht die Rechnung auf: Egal, ob analog oder digital zugespielt – jedwedes noch so schwierige Detail unserer Testdisc kam exakt auf der Leinwand an. Von schlechter kodierten Discs eben auch Artefakte, die der MPEGFilter "BAR" jedoch überdurchschnittlich gut herauspolieren konnte. Ein Manko des Projektors ist die Arbeit seinesDeinterlacers, der Halbbilder von "i"-Signalen wieder zu progressiven wandelt. Flimmern hier, Kanten da – das ist für einen Projektor mit diesem Chipsatz und in dieser Preisklasse nicht standesgemäß.

Auch beim HD-Zuspiel machten dem HC-5000 einige Szenen von der HD-DVD "Mission Impossible 3" Probleme. Zudem war ein Ruckeln in Bewegungen ersichtlich, das die anderen Kandidaten so nicht zeigten. Die Lösung kam mit dem Player HD-XE1 von Toshiba ins Haus (Test ab Seite 32). Er gibt progressive 1080p-Signale aus und erspart dem Projektor so die Wandlung. Bildfehler, die der HC-5000 bei der Interlace-Zuspielung von Toshibas Einsteiger- Player HD-E1 zeigte, waren damit passe. Für das Zuspiel von DVD-Signalen empfehlen wir ebenso einen Player mit Progressiv-Ausgang.
Vor allem das Kinoerlebnismit der HD-DVD "Mission Impossible 3" verzückte die Tester. Die für Actionfilme sehr natürliche Farbgebung brachte der HC-5000 überzeugend auf die Leinwand. Schwenks über dasMeer mit feinsten Details in den Wellen oder die aufgestellten Schulterhärchen der Filmpartnerin von Tom Cruise zeigten den Detailzugewinn der Full-HD-Auflösung deutlich.
Typische LCD-Bildschwächen wie Nachzieheffekte oder milchige Schwarzwerte scheinen wie bei Panasonics PT-AE1000E der Vergangenheit anzugehören. Lediglich das LCD-typische Fliegengitter versteckte der Mitsubishi nichtganzso gutwie der Panasonic, wasjedoch nur dem geübten Auge auffallen dürfte.
Der Platzhirsch: Panasonic PT-AE1000E
Seit gut sechs Jahren begeistert Panasonic die Heimkinowelt mit seinen LCD-Projektoren. Nicht weniger als sechs Generationen haben die emsigen Entwickler seither zu Wege gebracht – der PT-AE1000E markiert den Höhepunkt ihrer Bemühungen. 2003 hatman sich eine Hollywood-Dependance geleistet, in der neben Blu-ray-Authoring-Projekten auch die Abstimmung der Heimkino-Projektoren auf die Bedürfnisse der ortsansässigen Coloristen realisiertwird. Auch bei der Auswahl der Komponenten hat Panasonic keinerlei Mühen gescheut. Da hohe Auflösung alleine noch kein Qualitätsgarant ist, vertraut man für die Baugruppen fast ausschließlich auf Eigenentwicklungen. Für Objektiv, Prisma oder Farbfilter hat man Ingenieure aus dem ganzen Unternehmen – vor allem aus dem Foto- und Camcorderbereich – herangezogen.

Das bullige Design unterstreicht den qualitativ hohen Anspruch des PT-AE1000E: Mittig schaut die Linse wuchtig hervor, rechts und links erstreckt sich der weite Korpus mit seinen Lüfterschlitzen. Chic: Die Bedienelemente sind unter einer Klappe an der Seite desProjektors versteckt. Der einzige Kritikpunkt: Das schwarze Gehäuse dürfte ein bisschen metallischer aussehen.
Schon bei der Aufstellung erfreut der Projektor durch die extrem flexible Optik. Ein Zweifachzoom-Objektiv sowie der gewaltige Lensshift gewähren maximale Freiheit bei der Wahl des Projektionsstandortes. Über die beiden ergonomischen Drehräder auf der Oberseite des Projektors lässt sich das Bild um je eine Bildhöhe nach oben und unten und jeweils 40 Prozent nach rechts und links verschieben.
Auf der Rückseite befindet sich eine prall gefüllte Anschlussfront: Zwei HDMI-Eingänge und ein Komponententrio und eine VGA-Buchse schlucken HD-Signale. Lob: Für Settop-Boxen hat Panasonic extra eine RGB-Scart-Buchse integriert. Im Menü zeigt eine grafische Oberfläche die Schnittstellen und macht deren Bedienbarkeit damit zum Kinderspiel. Überhaupt setzt der Panasonic hier neue Maßstäbe. Als erster Bildgeber kommt der PT-AE- 1000E mit einem Waveform-Monitor.

Da er das ausgehende Signal darstellt, lässt sich der Projektor damit perfekt einstellen. Die richtigen Testbilder vorausgesetzt, lassen sich Helligkeit, Kontrast, Gamma sowie Farbsättigung ohne großen Aufwand justieren. AlsMessbereich lassen sich für die Luminanz oder die Primärfarben entweder eine Bildzeile oder das ganze Bild einstellen. Dadurch kann der Projektor ohne Probleme ebenfalls in kleineren Produktionsstudios als Referenzmonitor arbeiten. Lediglich für den optimalen Abgleich der Farbtemperatur bedarf es noch einesMessgerätes.
Das ansprechende Menü ist übersichtlich unterteilt. Viel wird man sich hier allerdings nicht aufhalten müssen, denn die Voreinstellung "Cinema 1" (laut Handbuch für Hollywood- Farben) trifft die Optimalwerte nahezu perfekt. Erwähnenswert ist an dieser Stelle das "Cinema Colour Management" – Profis gleichen hierüber Einzelfarben exakt auf Norm ab. Ein Hemmnis bei der Justage stellt die gut gemeinte Fernbedienung dar: Lernfähig, beleuchtet und mit drei programmierbaren Tasten eigentlich die besten Voraussetzungen, versagt ausgerechnet die Präzision desSteuerkreuzes. Die Trennung von rechts/links und oben/unten ist so schlecht, dass man beim Versuch, die Menüpunkte herabzuarbeiten, oft ausVersehen die Optimalwerte wieder verstellt. Einmal gefunden, sollten sie deshalb auf einer der zahlreichen Speicherbänke hinterlegt werden.
Die dynamische Iris im Panasonic stellt eine leichte Wahl: "Ein" oder "Aus". Die Messergebnisse sprechen hier eine klare Sprache: "Ein" erzielt mit einem Schwarzwert von 0,17 cd/m2 und einem ANSI-Kontrast von 1000:1 sehr viel bessere Werte als "Aus". Da Panasonic die Iris auf jedes Einzelbild abgleicht, bleibt deren Arbeit für den Zuschauer unsichtbar und sticht damit die Mitsubishi-Blende aus.
Beim Test mit PAL-Signalen belegte Panasonic seine Dominanz bei der Bildverarbeitungsqualität von Projektoren. Die Schärfe mit 576 Zeilen ist exzellent, gar besser als die des Mitsubishi HC-5000. Ein anderes Bild ergibt das Zuspiel von Full-HD-Signalen. Zwar übertrumpfte der PT-AE1000E den Mitsubishi in Sachen Deinterlacer – das Zusammensetzen von Halbbildern gelang ihm einwandfrei, bei der Bildschärfe muss er sich allerdings hinten anstellen. Der Grund dafür ist die nicht ganz perfekte Konvergenz, das heißt die Abstimmung der drei LCD-Chips aufeinander. Vor allem an den Bildrändern sind leichte Farbsäume zu erkennen. Dafür zeigt der PT-AE- 1000E keinerlei Fliegengitter, da Panasonics "Smooth-Screen"-Technologie die Zwischenräume der Pixel unsichtbar macht.

Das Großbild-Erlebnis mit den hoch auflösenden Scheiben "Mission Impossible 3" und "Die Bourne Verschwörung" war atemberaubend: reich an Details, reich an Kontrast, reich an Farben. Nur bei Letzteren hätte es stellenweise tendenziell ärmer zugehen dürfen. Der erweiterte Farbraum des Panasonic tendierte in kritischen Bildern zu etwas unnatürlichen Farben. Wie etwa in der "Bourne Verschwörung" bei Franka Potentes Streifzug über den Markt in Goa. Wenig später vermitteln die Bilder indes schon wieder die Sehnsucht eines tropischen Sonnenuntergangs, wie er schöner kaum reproduziert werden könnte. Nicht weniger knackig präsentiert der Beamer die Stoppeln des Dreitagebarts von Tom Cruise in der Anfangsszene von "Mission Impossible 3". Die Rauchkaskaden der selbstzerstörenden Nachricht ein Kapitel später zeigen repräsentativ die Bildplastizität des Panasonic.
Fazit:
Wow! Ein gelungenes Debüt. Das Bildfeuerwerk derbeiden Projektoren zog die Jury gleich mehrere Kinoabende lang in seinen Bann. Deutlich wurde: Ja, wir alle wollen Full-HDAuflösung, da die beiden Probanden deutlich mehr Details als 720p-Vertreter auf die Leinwand bringen. Aber auch, dass Auflösung nicht alles ist. Die Bewegungsdarstellung des Panasonic und dessen Kontraste, auf der anderen Seite die Farbgebung des Mitsubishi und dessen Schärfe, das wäre der perfekte Beamer. Zudem erinnert das leichte Fliegengitter desMitsubishi an alte LCD-Zeiten. Dem dargebotenen HD-Feuerwerk tut das allerdings keinen Abbruch.

OPTISCHE BLENDE
Optische Blenden findet man heutzutage in nahezu jedem LCD-Projektor. Ihre Bestimmung ist es, den Kontrast auf der Leinwand zu verbessern. Als Erstes reduzieren sie im Lichtweg des Projektors auftretendes Streulicht. Zusätzlich passen sich moderne Blenden dem Bildinhalt dynamisch an. In dunklen Szenen lassen sie weniger Licht passieren, um tiefere Schwarztöne zu ermöglichen. Sie senken damit aber auch die maximale Helligkeit. In hellen Bildern öffnen sie sich, um möglichst viel Licht passieren zu lassen. Die Blende des Panasonic (oben) ist eine der am weitesten entwickelten in diesem Bereich. Sie passt sich dem Inhalt jedes Einzelbilds an und schafft 256 verschiedene Einstellstufen. Die Iris des Mitsubishi gleicht ihre Öffnung – wie das bei den allermeisten Projektoren der Fall ist – lediglich einige Male pro Sekunde ab. In schnellen Hell/dunkel-Wechseln fällt der verzögerte Wechsel unangenehm auf. Auch das Betriebsgeräusch kann durch ein hörbares Surren für unerwünschte Aufmerksamkeit sorgen, was bei den zwei Testkandidaten allerdings nicht der Fall ist.
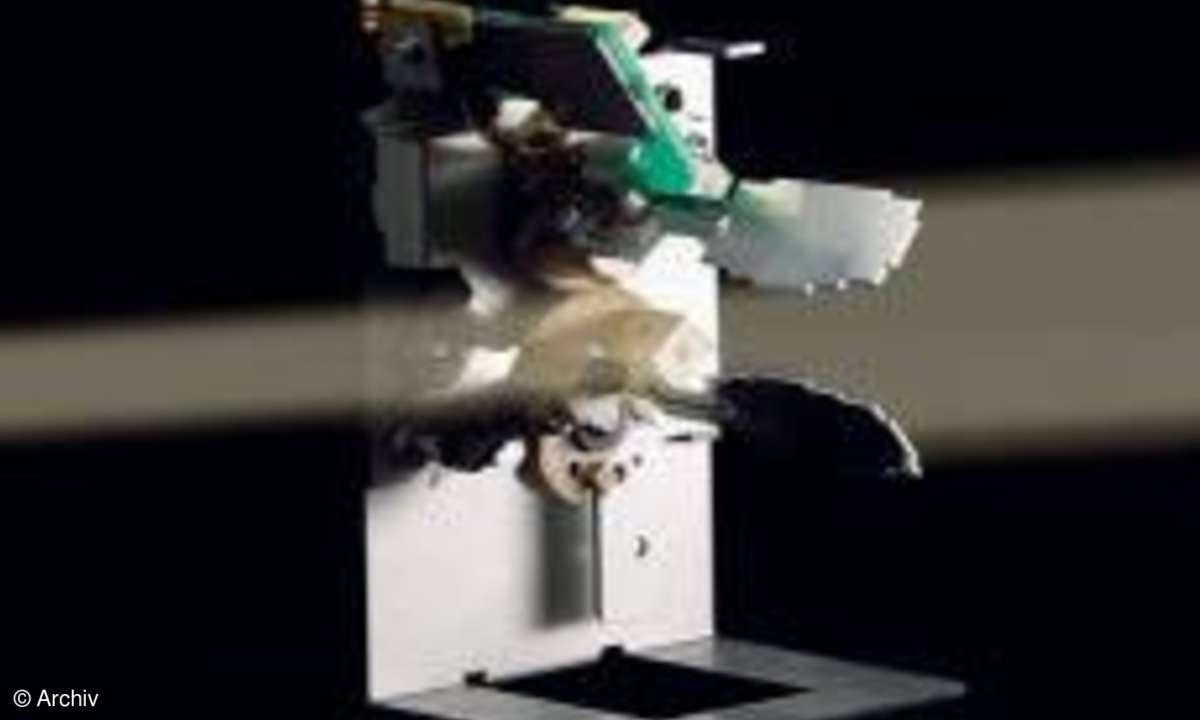
Hoffnungsträger
Noch ist er nicht da – aber wenn der Panelproduzent Hand anlegt, darf man Großes erwarten. HomeVision hat den EMP-TW1000 vorab angeschaut.

Ein weiterer Konkurrent stößt in den nächsten Wochen zu den Einstiegs-Full-HD-Beamern: der Epson EMP-TW1000. Zum Redaktionsschluss gab es noch kein finales Produkt – Epson war allerdings so freundlich, unsere Neugier durch ein Vorserienmodell zumindest teilweise zu stillen Mit 4.000 Euro kostet er so vielwie der Mitsubishi HC-5000. Da Epson der Hersteller der LCD-Panels ist, dürften die Japaner hier einen Preisvorteil auskosten.
Äußerlich ist der 1080p-Projektor deutlich an den erfolgreichen 720p-Modellen angelehnt. Neu ist allerdings der Metallic-anthrazit-Look, der ihm hervorragend steht. Vorne sticht die bullige Linse heraus. Der geriffelte Rand zeigt es: Den 2,1-fach Zoom, den Fokus sowie den gewaltigen Lensshift muss man manuell justieren. Neben dem Objektiv prangt ein Kühlergrill, der die Abluft nach außen bläst.

Im Gegensatz zu den extrem leisen Probanden von Mitsubishi und Panasonic röhrt das Vorserienmodell hörbar. Auf der Rückseite versteckt sich die vergleichsweise schmale Anschlussfront. Zwar sind mit HDMI, Komponententrio und VGA alle wichtigen Eingänge abgedeckt – einen zweiten Digitaleingang hätten wir uns trotzdem gewünscht. Eine Spezialbuchse fasst dafür über einen optional erhältlichen Scart-Adapter auch RGB-Signale.

Das Menü dürfte die Epson-Kenner nicht überraschen. Neben einigen marketingträchtigen Bildverschlimmbesserern wie "Epson Super-White" oder Hauttonkorrektur findet sich eine Vielzahl ganz hervorragender Einstellmöglichkeiten: eine neunbandige Gammakorrektur, eine sehr detaillierte Schärfeeinstellung oder eine einstellbare Bewegungserkennung. Die Arbeit der Letzteren hat unswie die des PT-AE1000E sehr überzeugt: Selbst in 60 Hz zerstückeltes 24p-Material von Blu-ray und HD-DVD gaben die beiden Probanden flüssig auf die Leinwand.

Eine automatische Iris bringt auch der Epson mit – leider hörtman deren Arbeit deutlich. Dafür sorgt sie für sagenhafte InBild- Kontraste, die dem Epson zu einer Plastizität par excellence verhelfen. Zusammen mit der hervorragenden Farbdarstellung gelingtdem Beamer damit eine außerordentlich gute Reproduktion des Filmmaterials. Wenn Epson an der Betriebslautstärke noch etwas feilt, steht mit dem EMP-TW1000 ein weiterer Stern am Beamerhimmel ins Haus.
STANDPUNKT
Nach den Displays erobert die Full-HD Auflösung nun die Beamerwelt. Die Ingenieure der Projektorenschmieden haben sich zwar Zeit gelassen, dafür allerdings auch sehr ausgereifte Produkte zu Werke gebracht. Im Vergleich zu aktuellen Full-HD-Fernsehern punkten die Projektoren durchweg mit der besseren Signalverarbeitung.

Kinderkrankheiten wie nicht abschaltbare Overscans mit Full-HD-Signalen sind in der Projektorenwelt tabu. Auch an die Verarbeitung von 1080p-Signalen mit einer Wiederholrate von 24 Bildern haben alle Hersteller schon gedacht. Wir erinnern uns: Das 24p-Quellmaterial muss derzeit auf 60 Hertz umgerechnet werden, was auf dem Screen zu unangenehmen Rucklern führt. Noch sind zwar keine Abspielgeräte mit 24p- Ausgang verfügbar – alle getesteten Projektoren sind jedoch hierfür vorbereitet. Gerne dürfen, ja müssen sich die Displayschmieden hier eine Scheibe abschneiden. Denn immer mehr Kunden greifen zum Beamer. Kein Wunder: Die HD-Signale eignen sich für quadratmetergroße Flächen perfekt. Und wer einmal in den Genuss eines Films in HD-Auflösung auf einem entsprechenden Projektor gekommen ist, will dieses Erlebnis auch zu Hause haben. Willkommen in einer neuen Dimension der Heimunterhaltung, die gerade erst begonnen hat.