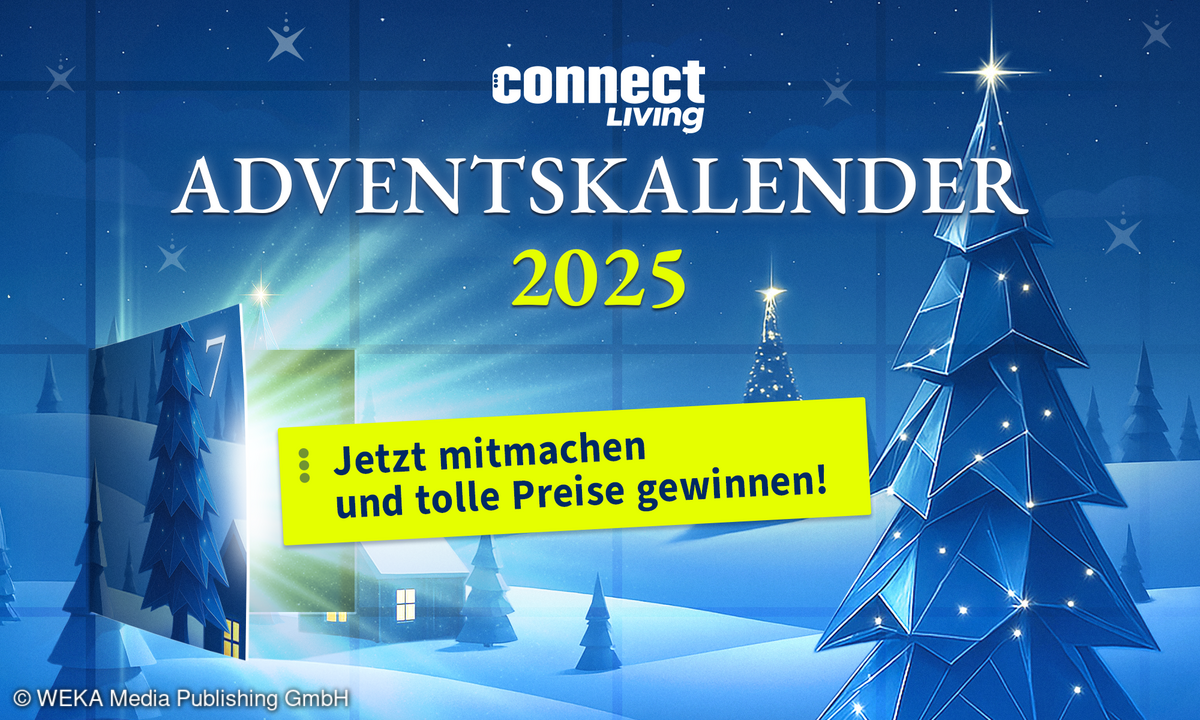Teil 2: E-Business: Online-Recht
- E-Business: Online-Recht
- Teil 2: E-Business: Online-Recht
Obgleich es noch keine abschließende Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) zu der Frage gibt, ist die inzwischen überwiegend vertretene Ansicht, dass in der Verwendung fremder Marken als Metatag oder bei Adwords-Kampagnen ein Markenrechtsverstoß zu sehen ist. Wie erwähnt, vertreten insbesond...
Obgleich es noch keine abschließende Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) zu der Frage gibt, ist die inzwischen überwiegend vertretene Ansicht, dass in der Verwendung fremder Marken als Metatag oder bei Adwords-Kampagnen ein Markenrechtsverstoß zu sehen ist. Wie erwähnt, vertreten insbesondere Braunschweiger Gerichte diese Auffassung, beispielhaft sei hierzu ein aktuelles Urteil des LG Braunschweig vom 28. Mai 2008 (Aktenzeichen: 9 O 367/08) genannt. Aber auch das OLG München (Urteil vom 6. Dezember 2007, Aktenzeichen: 29 U 4013/07) oder das OLG Stuttgart (Urteil vom 26. Juli 2007, Aktenzeichen: 2 U 23/07) sind der gleichen Meinung.

Einige wenige Gegenstimmen kommen seitens der Oberlandesgerichte aus Frankfurt a.M. (Urteil vom 26. Februar 2008, Aktenzeichen: 6 W 17/08), Köln (Urteil vom 31. August 2007, Aktenzeichen: 6 U 48/07) oder Düsseldorf (Urteil vom 23. Januar 2007, Aktenzeichen: I-20 U 79/06).
Natürlich sind die Entscheidungen auf diesem Gebiet nicht alle identisch, teilweise werden verschiedene Aspekte unterschiedlich gewichtet oder gewisse Umstände im Sachverhalt weichen voneinander ab, im Kern dreht sich jedoch alles um die Verwendung fremder Marken. Ein rechtlicher Knackpunkt ist dabei auch die Option weitgehend passender Keywords, die es als Einstellungsmöglichkeit bei Google gibt.
Ist diese Option aktiviert, wird die betreffende Werbeanzeige möglicherweise auch dann angezeigt, wenn Nutzer der Suchmaschine nicht den genauen Wortlaut der Marke, sondern einen anderen Begriff eingeben, der einen inhaltlichen Bezug zu dem geschützten Markenbegriff aufweist. Es gibt noch weitere Gesichtspunkte, die eine Rolle spielen. Selbst das OLG Braunschweig ist im Urteil vom 26. März 2008 (Aktenzeichen: 9 O 250/08) von seiner eigentlich strikt verfolgten Linie abgewichen und hat ausnahmsweise die Verwendung einer fremden Unternehmensbezeichnung nicht als Markenrechtsverletzung angesehen. Zwar verneinten die Braunschweiger Richter hier nicht grundsätzlich die Möglichkeit eines Verstoßes gegen das Markenrecht, sahen allerdings im konkreten Einzelfall gerade keine Rechtsverletzung. Dabei stellte das Gericht auf die Wahrnehmung der Trefferanzeigen nach Eingabe des Suchbegriffs durch den Suchmaschinennutzer ab. Inhaltlich handelte es sich um die Anzeige einer Rechtsanwaltskanzlei, die den fremden Begriff gerade nicht als Bezeichnung für ein eigenes Produkt verwendet hatte, sondern dazu, um Rechtssuchenden zu verdeutlichen, in welchen Fällen (hier: Anlagerecht) es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommen kann.
Fazit: Grundsätzlich sollten also Google-Adwords-Anzeigenkampagnen mit Vorsicht genossen und sehr genau auf etwaige Markenrechtsverletzungen untersucht werden. Im Zweifel ist bereits im Vorfeld fachmännischer Rat einzuholen. Denn bis zu einer BGH-Entscheidung drohen kostenintensive Abmahnungen, da sich die Konkurrenz im Zweifel aufgrund des sogenannten fliegenden Gerichtsstandes für den passenden Gerichtsort entscheiden kann. Falls also das Verfahren vor das LG Braunschweig gelangt, braucht man nicht viel Fantasie um erraten zu können, wie die Sache wohl ausgehen wird.

eBay-Handel
Anfang 2008 hatte der Schultaschenhersteller Scout für Aufsehen gesorgt, als er einem eBay-Händler den Verkauf seiner Produkte untersagte. Dieses Vertriebsverbot bestätigte das LG Mannheim mit Urteil vom 14. März 2008 (Aktenzeichen: 7 O 263/07). Die Mannheimer Richter sahen im Lieferstopp seitens Scout keine Handlung auf dem Gebiet des Wettbewerbs, sondern einen in dem Fall zulässigen selektiven Vertriebsvertrag. Ein solcher ist immer dann kartellrechtlich rechtmäßig, wenn objektive Qualitätskriterien für die Auswahl der Vertriebspartner zugrunde gelegt werden.
Grundsätzlich ist beim Verkauf von Markenartikeln immer der sogenannte Erschöpfungs-Grundsatz zu beachten (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Nach diesem dürfen Produkte, welche mit Zustimmung eines Markenherstellers innerhalb der EU in den Verkehr gebracht werden, auch von anderen Verkäufern im Gebiet der EU weiterveräußert werden. Dieser Erschöpfungsgrundsatz ist etwa dann verletzt, wenn Waren aus Nicht-EU-Staaten importiert werden. Eine Ausnahme hiervon bilden allerdings die selektiven Vertriebssysteme beziehungsweise entsprechende Einzelvereinbarungen.
Im Gegensatz zum LG Mannheim hatte das LG Berlin am 24. Juli 2007 (Aktenzeichen: 16 O 412/07) geurteilt, dass die Vereinbarungen von Scout mit seinen Vertriebspartnern, welche den Verkauf der Produkte über Plattformen wie eBay untersagten, einen Verstoß gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) darstellten. Durch derartige Vereinbarungen würde die Handlungsfreiheit der beteiligten Vertriebspartner in unzulässiger Weise eingeschränkt, so das Berliner Landgericht.
Auch hier ist also die Problematik noch nicht geklärt. Letztlich muss anhand des Einzelfalles entschieden werden, ob etwaige Vertriebsvereinbarungen wirksam oder eventuell unwirksame Klauseln enthalten sind. Ratsam ist bereits im Vorfeld eine Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller oder Vertriebspartner, ob Verkäufe über eBay zugelassen sind.