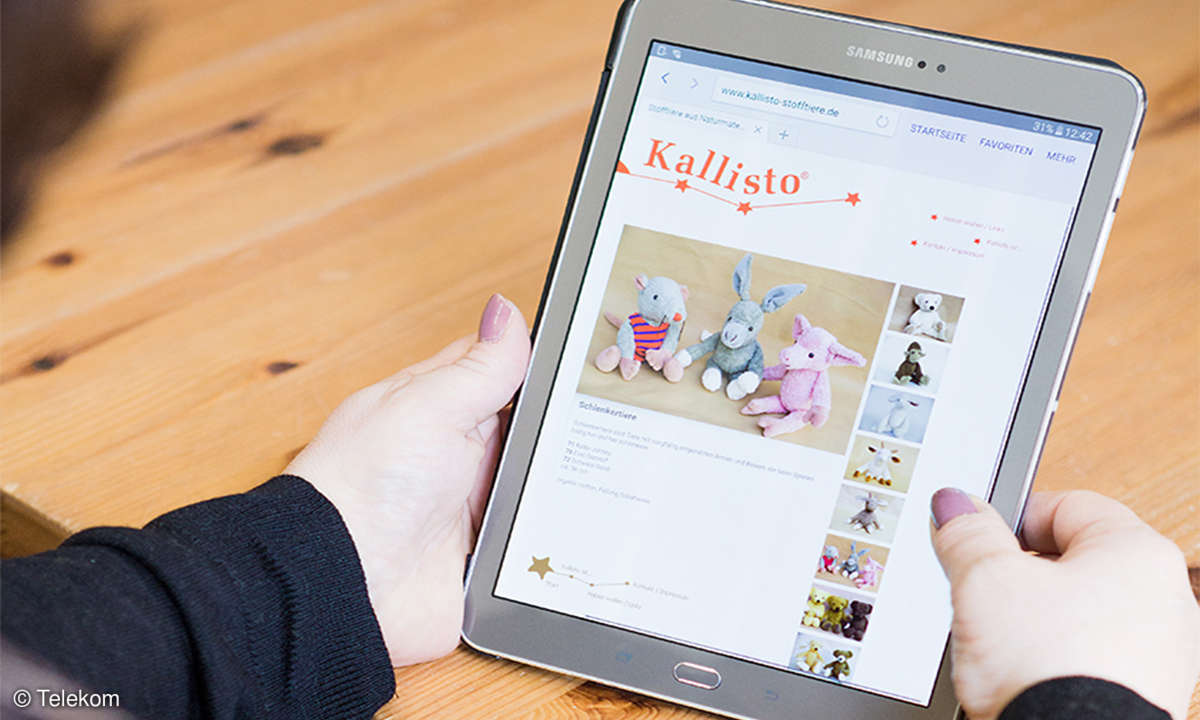ERP - Der Mensch im Mittelpunkt
Setzt man technische Professionalität voraus, ist bei ERP-Projekten die Fokussierung auf die betroffenen Anwender und beteiligten Stakeholder einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren.

Die drei wichtigsten Elemente dabei sind die Projektführerschaft durch die Fachabteilung, die kontinuierliche Kommunikation mit allen Beteiligten und deren Begleitung durch ihren persönlichen Veränderungsprozess.Noch vor wenigen Jahren galt die Neueinführung eines ERP-Systems als...

Die drei wichtigsten Elemente dabei sind die Projektführerschaft durch die Fachabteilung, die kontinuierliche Kommunikation mit allen Beteiligten und deren Begleitung durch ihren persönlichen Veränderungsprozess.
Noch vor wenigen Jahren galt die Neueinführung eines ERP-Systems als rein technisches IT-Projekt, und das in zweifacher Hinsicht: Das Herzstück des neuen Systems bestand aus der Software-Lösung, und es war die IT-Abteilung, die das System gemeinsam mit dem Lieferanten einführte. Schließlich war sie in vielen Unternehmen diejenige Abteilung, die das meiste Wissen über die Arbeitsabläufe im Unternehmen hatte.
Daraus holte sich die IT die Legitimation, für alle gleichermaßen zu entscheiden, das Beste für alle zu definieren und jenseits des Interesses einzelner Fachabteilungen hinaus für das Wohl des gesamten Unternehmens zu handeln. Diese Selbstwahrnehmung der IT wurde durch das partielle Unwissen der Fachabteilungen und deren oftmalige Skepsis gegenüber der Informationstechnik verstärkt, trug aber in vielen Fällen zum Scheitern von ERP-Einführungsprojekten bei.
Die vermeintlich beste Lösung wurde nicht angenommen, die Endanwender fanden sich in ihrem Alltag im neuen System nicht zurecht und fühlten sich nicht wahr- bzw. ernst genommen. Die IT bekam die Schuld und das System konnte "ja so nicht funktionieren"
Die Kosten, die das Projekt verursachte, standen in keinem Verhältnis zum realisierten Nutzen, die Endanwender waren "restlos bedient", und nicht selten scheuten sich die Unternehmen, das Thema ERP-Einführung noch einmal anzugehen: Sie zogen es vor, das alte System bis an seine Grenzen - und darüber hinaus - auszureizen und ja nicht an eine Neuinstallation zu denken.
ERP-Systeme nutzen Innovationspotenzial
Heute hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass ERP-Projekte zwar einen nicht geringen Anteil an Informationstechnik realisieren, dass sie im Grunde aber Vorhaben zur Weiterentwicklung der Organisation sind. Projekte schaffen Innovationen und sind damit synonym mit Veränderung.
Quasi alles verändert sich mit dem neuen ERP-System. Der Anspruch der Effizienzsteigerung, die mit dem neuen ERP-System erreicht werden soll, stellt in vielen Fällen die gelebten Arbeitsabläufe in Frage und geht einher mit massiven Bestrebungen, die Prozesse in den einzelnen Abteilungen, zwischen den Abteilungen und nicht selten auch hin zu Lieferanten und Kunden zu optimieren.
Höherer Stellenwert für den Menschen
Daraus speist sich die Erkenntnis, dass den Menschen während des Projektes ein anderer Stellenwert zuzuschreiben ist, als dies bisher der Fall war. Der Mensch wird zur entscheidenden Ressource für erfolgreiche Projekte. Damit ist nicht etwa seine reine Arbeitskraft gemeint, sondern sein Verhalten im Projekt und für - oder gegen - die Projektergebnisse.
Im Grunde ist damit seine Fähigkeit gemeint, sich Veränderungen im Leben zu stellen und bei richtiger Unterstützung diese Veränderungen sogar aktiv zu gestalten.
Was bedeutet dies in modernen ERP-Projekten? Es sind vor allem drei Aspekte, die dem Faktor Mensch in ERP-Projekten Rechnung tragen und die den Erfolg der ERP-Einführung maßgeblich beeinflussen:
- Die Fachbereiche sind die treibende Kraft in ERP-Projekten, nicht die ITAbteilung.
- Organisationen bestehen aus Menschen, deren Erwartungen zu managen sind.
- ERP-Projekte sind organisatorische Veränderungsprojekte.
Die Rolle der Fachabteilungen
Projekte werden durchgeführt, um die Zukunftsvisionen des Unternehmens umzusetzen. Projekte machen aus Ideen Innovationen. Damit hat jedes Projekt einen unvergleichlichen und ganz spezifischen Nutzen für das Unternehmen und der ist gleich zu Beginn schriftlich zu formulieren.
Man sollte sich eindeutig klarmachen, welche Geschäftsprozesse (bis hin zu einzelnen Arbeitsschritten) das ERPSystem unterstützt oder gar erst ermöglicht. Der Lösungsanbieter Würth Phoenix setzt beispielsweise bei der Implementierung von Microsoft Dynamics AX als ERP-System SureStep, Microsofts Methodensammlung für das Projektmanagement, ein.
Die eben erwähnten Nutzenargumentationen finden dort im Business Case als Teil des Project Charter ihren Platz. Der Project Charter ist das zentrale Dokument des Kunden, das seine Vision, den erwarteten Nutzen und die Ziele, die er mit dem Projekt verbindet, dokumentiert und kommuniziert.
Wenn man ERP-Projekte als Organisationsprojekte betrachtet, folgt daraus, dass der Projekt- Sponsor bzw. Auftraggeber ein maßgeblicher Entscheider in der Kundenorganisation ist, am besten der Geschäftsführer selbst oder ein Mitglied der Geschäftsführung. Dieser Sponsor sollte als direkten Ansprechpartner für das Projektteam einen seiner Fachabteilungsleiter bestimmen.
Sitzen darüber hinaus alle vom Projekt betroffenen Fachbereichsleiter und ein Vertreter der späteren Anwender im Lenkungsausschuss, so ist die strukturelle Vorsorge dafür getroffen, dass die Beteiligten im Unternehmen die ERP-Einführung maßgeblich mitgestalten - und nicht nur die IT-Abteilung. Dies erhöht die kurzfristigen Erfolgsaussichten ebenso wie die langfristigen Nutzenaussichten.
Menschen und ihre Erwartungen
Deswegen legt Würth Phoenix einen besonderen Schwerpunkt auf die Kommunikation mit allen Beteiligten und Betroffenen - den sogenannten Stakeholdern - im Projekt. Das beginnt mit der obligatorischen Stakeholder-Analyse, bei der die Endanwender und die Fachabteilungen wichtige interne Stakeholder-Gruppen sind.
In einem Diagramm werden Stakeholder identifiziert und es wird grob klassifiziert (über Smiley-Symbole), welche emotionale Einstellung sie gegenüber dem Projekt haben (nach der subjektiven Ansicht der Analysierenden). In der sich anschließenden Analyse ergeben sich Antworten auf die folgenden wichtigen Fragen:
- Welche Macht hat der Stakeholder, die Projektergebnisse zu beeinflussen?
- Welches Interesse am Projekt hat er?
- Wie könnte er dem Projekt nutzen bzw. schaden? Wie kann das Projekt ihm nutzen oder schaden?
Diese Reflexion führt zu einer Reihe von möglichen Stakeholder-spezifischen Maßnahmen, die auf die Absicherung der Projektziele abzielen. Die allermeisten Maßnahmen finden sich dann im Kommunikationsplan wieder, der wesentliche Elemente und Kanäle der zielgruppenspezifischen Kommunikation im Projekt enthält.
Je erfahrener die ERP-Implementierer sind, desto effektiver sind solche Kommunikationspläne, die weit über reine Informationsverteiler wie beispielsweise den Projekt-Statusbericht hinausgehen und Elemente moderner Workshop-Interventionen ebenso enthalten wie spezifische Kontaktpunkte der Stakeholder-Kommunikation.
Den Wandel moderieren
Viele Menschen antworten zunächst einmal mit negativen Emotionen auf Veränderungsimpulse und folgen mehr oder weniger einem Veränderungskreislauf mit mehreren Stufen. Projektleiter müssen das wissen und die richtigen Instrumente einsetzen sowie auf die Menschen konkret eingehen. So nehmen sie Menschen mit auf den Weg der Veränderung, begleiten sie bestmöglich in ihrem Veränderungsprozess und nehmen ihre Ängste, aber auch ihre Erwartungen ernst.
Aus den vielen theoretischen Veränderungsmodellen macht Würth Phoenix die besten Erfahrungen mit einem sechsstufigen Modell: Unabhängig von der Art einer Veränderung, sei sie beruflicher oder privater Art, reagieren Menschen in der ersten Phase des Verlustes mit einem Gefühl der Angst und verhalten sich wie gelähmt.
Wenn sie weiter in den Veränderungsprozess eintauchen, durchlaufen sie nacheinander die Phasen des Zweifelns und Unbehagens, Entdeckens und schließlich des Verstehens und der Integration. Jede Phase bedingt bei den Beteiligten emotionale und rationale Muster, die jeweils ein spezifisches schwerpunktmäßiges Verhalten auslösen.
Die Menschen im Projekt mitzunehmen bekommt hier eine konkrete Bedeutung: Der Projektleiter kann sie je nach ihrem Veränderungszustand mit eigenem Verhalten wie gezielten Maßnahmen unterstützen und so zum Projekterfolg wesentlich beitragen.
Fazit
Werden die genannten drei zentralen Aspekte im ERP-Projekt beachtet, steigen die Erfolgschancen für dessen nachhaltige Umsetzung erheblich. Dann lässt sich auch der Nutzen erzeugen, den sich das Unternehmen zu Beginn des Projekts erhofft. Und die Akzeptanz durch die Anwender ist geschaffen.