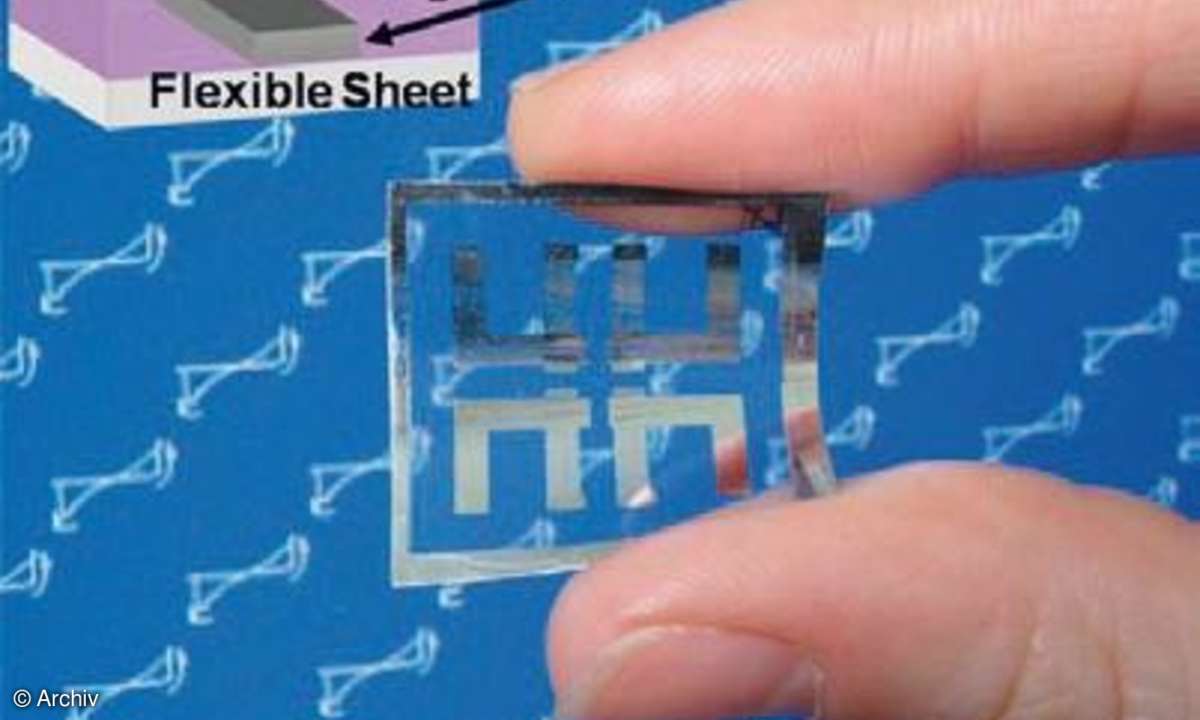Neue Speicher und CPU: Der Wunderbaustein von morgen?
Grundlegende Neuerungen sind in der Elektrotechnik eher selten. Nun wurde mit Memristoren das lang gesuchte, vierte passive Bauelement gefunden - mit weit reichenden Konsequenzen für die Computerbranche.
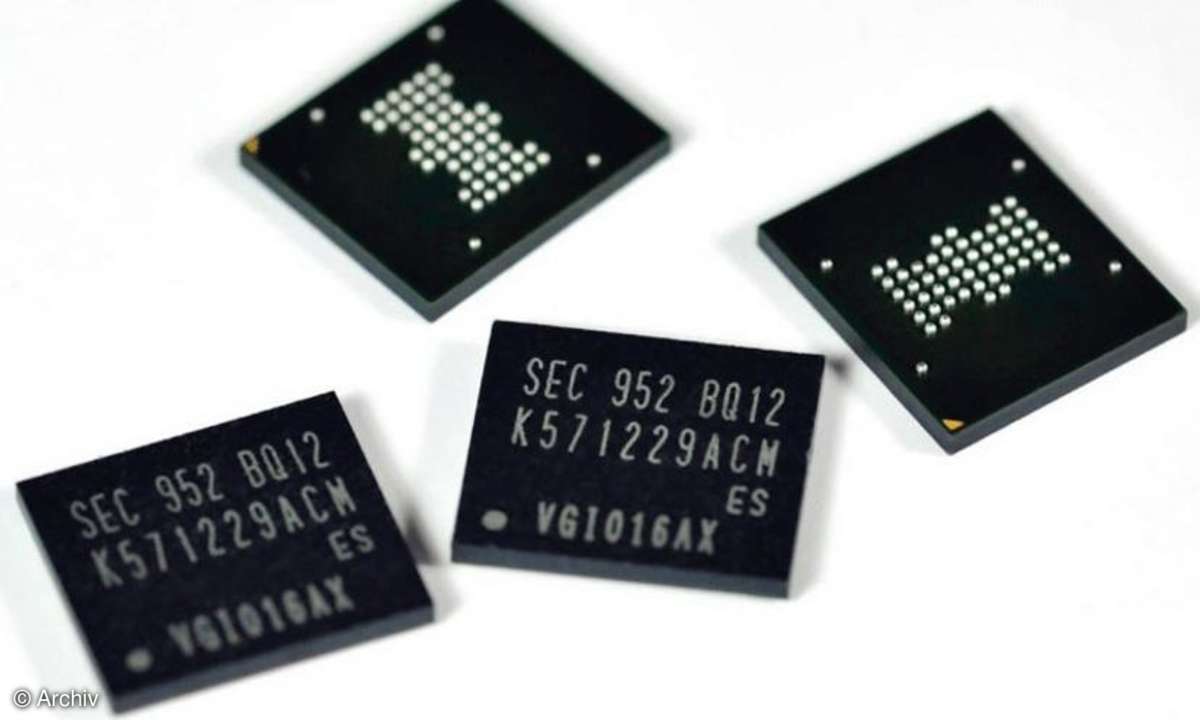
- Neue Speicher und CPU: Der Wunderbaustein von morgen?
- Weitere Details und Fazit
Wirft man den Begriff "Memristor" in die Runde, zucken selbst ausgebuffte Elektronik-Profis mit den Achseln. Das Spektum der Reaktion reicht dabei von "was soll das sein?" über "nie gehört" bis "Ist das jetzt ein Scherz oder gibt es das wirklich?". Dabei existiert der genannte Begriff seit den fr�...
Wirft man den Begriff "Memristor" in die Runde, zucken selbst ausgebuffte Elektronik-Profis mit den Achseln. Das Spektum der Reaktion reicht dabei von "was soll das sein?" über "nie gehört" bis "Ist das jetzt ein Scherz oder gibt es das wirklich?". Dabei existiert der genannte Begriff seit den frühen 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts.
Bereits 1971 hat ein gewisser Leon Chua - seines Zeichens Professor an der Berkeley Universität und ohne Zweifel mehr Mathematiker als Kupferwurm - ein Bauteil postuliert, das neben Widerstand, Kondensator und Spule das vierte passives Bauteil darstellen müsste. Dabei bewies er auch gleich mathematisch zwingend, dass die Eigenschaft dieses, von ihm selbst als "Memristor" bezeichneten, Bauteils nicht durch eine Kombination der anderen drei passiven Bauteile ersetzt werden kann.
Die vierte Kraft
Dass es ein fehlendes Glied geben müsste, schloss Chua aus einem Diagramm, das Spannung, Strom, Ladung und magnetischen Fluss in einem Koordinatensystem darstellt. Dort gibt es eine elektrische Größe, die den Zusammenhang zwischen Spannung und Strom herstellt - den Widerstand mit seinem gleichnamigen Bauteil. Zudem findet sich eine Größe, die Spannung und Ladung unter einen Hut bekommt - die Kapazität, mit dem Kondensator als Bauteil.
Und schließlich bilden Strom und (magnetischer) Fluss die Induktivität mit der Spule als korrespondierendem Bauteil. Nur der letzte Quadrant war bislang leer: Für den Zusammenhang zwischen Ladung und Fluss gab es weder eine Größe noch das passende Bauteil. Chua füllte diese Lücke - ganz nach der Art eines Theoretikers - mit der "Memristanz" als Größe und dem "Memristor" als Bauteil.
Theorie und Praxis
Die Suche nach dem verheißungsvollen, vierten passiven Bauelement erwies sich als schwierig und langwierig, zumal die theoretischen Grundlagen Professor Chuas nur einem verhältnismäßig kleinem Kreis von Forschern bekannt waren. Im Jahr 2007 gelang es schließlich Stanley Williams von den HP Labs in Palo Alto, Kalifornien, einen Memristor herzustellen, in dem er zwei Schichten von unterschiedlich dotierten Titanoxid auf einen Platinträger aufbrachte.
Je nach Stromfluss und Richtung wandern darin Fehlstellen (Löcher) der -p-dotierten Titandioxid-Schicht in ihr isolierendes Pendant und senken so den Widerstand. Bei umgepolter Stromleitung ziehen sich die "Löcher" weiter in die -p-dotierte Schicht zurück, der Widerstand steigt. Damit erhielt Williams ein Bauteil, das seinen Widerstand in Abhängigkeit des Stromflusses und dessen Richtung ändert.
Stellt man sich den Stromkreis wie einen Wasserkreislauf vor, wäre ein Memristor wie ein Stück Leitung, das seine Dicke ändern kann. Solange kein Wasser oder sehr wenig fließt, entspräche der Memristor einer moderaten Engstelle. Erhöht sich der Durchfluss in der einen Richtung, würde der Schlauch dicker - entsprechend die Engstelle entschärft, der Widerstand sinkt. Fließt das Wasser in die andere Richtung, zieht sich der Schlauch zusammen - die Engstelle setzt dem sie durchfließenden Medium einen höheren Widerstand entgegen.
Der eigentliche Clou liegt aber darin, dass der Memristor seinen - durch Richtung und Stärke des Stromflusses angenommenen - Widerstand auch dann beibehält, wenn kein Strom mehr fließt. Er merkt sich gleichsam seinen letzten Zustand, woraus sich auch der aus Memory (Gedächtnis) und Resistor (Widerstand) gebildete Name erklärt.
Gleich dem Gehirn
Schon der Vordenker Leon Chua war sich sicher, dass der gesuchte Baustein weitgehend der Funktionsweise der Synapsen unseres Gehirns entspricht und das mittels des Memristors sehr effektiv neuronale Netze aufgebaut werden können. Entsprechend gibt es eine Reihe von Forschungsprojekten, die sich mit neuronalen Netzen auf Memristor-Basis beschäftigen.
Das Potenzial wäre enorm. Gelänge es, ein räumliches Gitter aus Memristoren in der Strukturgrößen von einigen Nanometern herzustellen, wären Speicherdichten weit jenseits derer unseres Gehirns denkbar - überdies verbunden mit Schaltzeiten, die viele Größenordnungen unterhalb der unserer Nervenzellen liegen.
Entsprechend denken besonders kühne Forscher bereits über eine Art Zusatz- oder Ersatzspeicher für das menschliche Gehirn nach. Freilich ist man derzeit von der praktischen Umsetzung solcher Anwendungen noch Lichtjahre entfernt. Immerhin könnten aber neuronale Netze auf Memristor-Basis bisherige technische Umsetzungen _ wie sie z.B. bei der Zeichen- und Spacherkennung eingesetzt werden - revolutionieren.