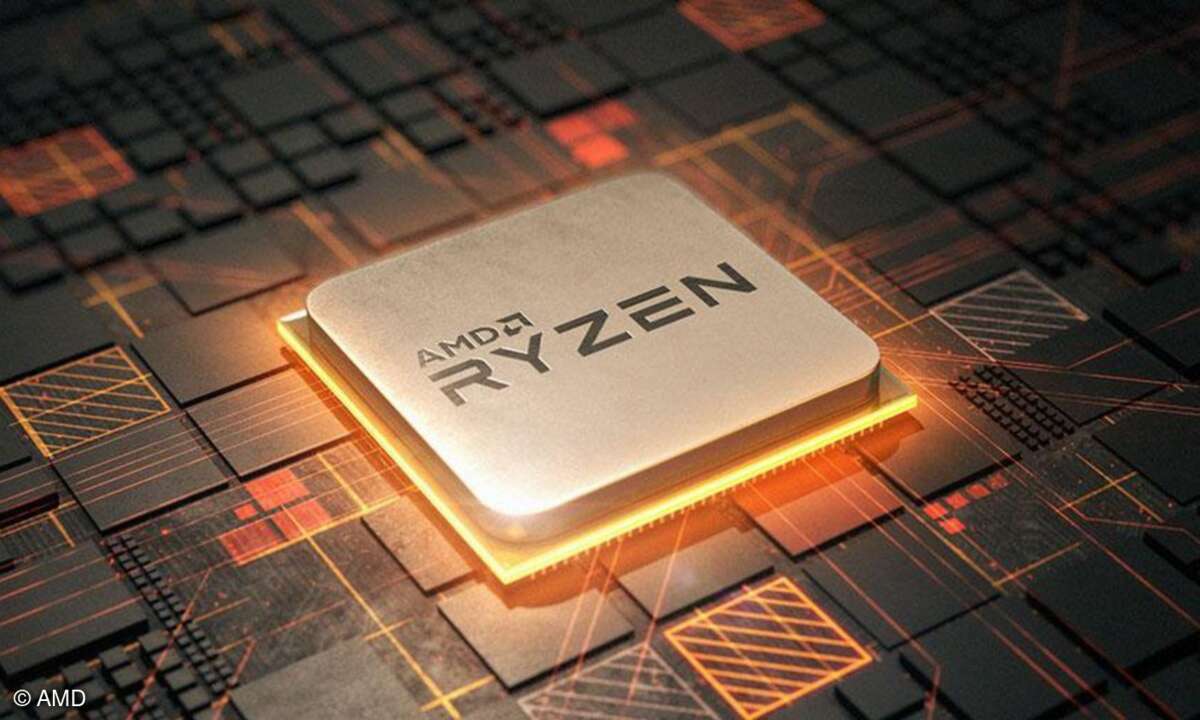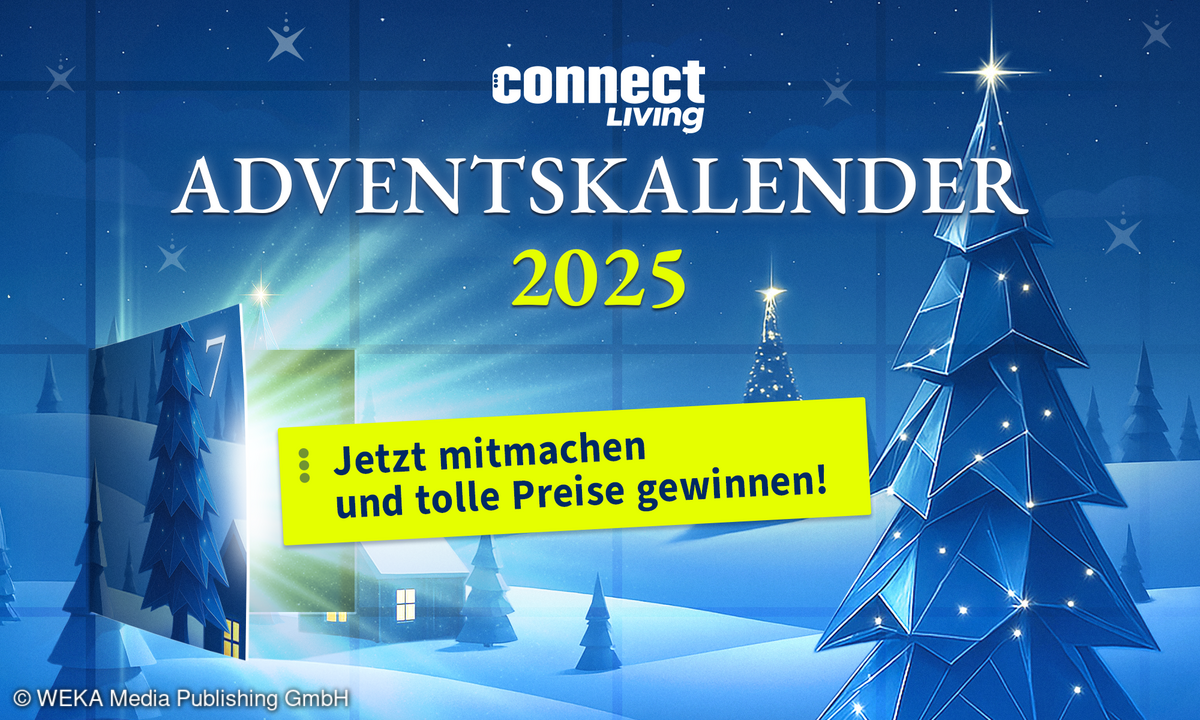In der Praxis überzeugend
- "Digitale Dividende": Hoffnung für schnelles DSL in ländlichen Regionen?
- In der Praxis überzeugend
- Aktueller Stand bei den Providern
Weiterfahrt dann in eine einige Kilometer vom Sender entfernte Gemeinde. Mitten im Neubaugebiet wird das Messfahrzeug geparkt und mit professionellem Messequipment von Rohde & Schwarz weiter gemessen: Ein Download läuft mit über 6 Mbit/s; wird kurze Zeit später parallel ein Zweiter gestartet,...
Weiterfahrt dann in eine einige Kilometer vom Sender entfernte Gemeinde. Mitten im Neubaugebiet wird das Messfahrzeug geparkt und mit professionellem Messequipment von Rohde & Schwarz weiter gemessen: Ein Download läuft mit über 6 Mbit/s; wird kurze Zeit später parallel ein Zweiter gestartet, pendeln sich beide bei rund 4 Mbit/s ein.Das alles ist beachtlich, aber noch keine Besonderheit und natürlich auch mit normalen UMTS-Systemen erreichbar - aber eben nicht mehr in dieser Entfernung. Die eigentliche Besonderheit kommt wieder einige Kilometer weiter: in einem Ort, der gut neun Kilometer Luftlinie vom Sender entfernt liegt. Von hier ist das Schloss kaum noch zu sehen, die Messsysteme zeigen aber immer noch einen Empfangspegel von 86 dm an - eine ordentliche Leistung.
Und selbst hier, in neun Kilometer Entfernung, pumpt das System immer noch gut 4 Mbit/s durch die Luft - mit normalem UMTS wäre an dieser Stelle kein Signal mehr empfangbar und damit gar keine Datenübertragung mehr möglich. Und genau hier wird die Besonderheit der begehrten Frequenzen sichtbar: Um ein vergleichbares Gebiet zu versorgen, wären mit konventionellem UMTS auf 2100 MHz ungefähr drei Sendeanlagen notwendig - also der vorher beschriebene Aufwand mal drei.
Grund ist die niedrige Frequenz. Denn je höher die Frequenz, desto mehr wird das Funksignal von Hindernissen wie Bäumen, Mauern, Fenstern oder Luftmolekülen gedämpft. Diesen Effekt erlebt man auch im normalen Mobilfunk: Wer ein GSM-Netz statt mit 900 MHz mit überwiegend 1800 MHz betreibt, also ein E-Netz, braucht deutlich mehr Funkstationen - ein Nachteil, den E-Plus und O2 seit Langem beklagen.
Neues Netz zum günstigen Preis
Und so wird bei der digitalen Dividende schnell klar, wohin der Hase läuft: Zwar lohnt es sich in der Tat so eher auch im ländlichen Bereich, größere Flächen zu versorgen, die Absicht der Mobilfunker ist aber eine andere: Sie wollen mit weniger finanziellen Mitteln ein weiteres Mobilfunksystem aufbauen, das natürlich dann auch in größeren Städten und für Handys genutzt werden soll.

Das ist zwar nichts Verwerfliches, nur kommt in der Kommunikation der Mobilfunker etwas anderes rüber.
Den Braten hat natürlich auch die für die Frequenzvergabe zuständige Bundesnetzagentur gerochen und bastelt derzeit an den Versteigerungsmodalitäten und Lizenzbedingungen: Demnach sollen die Netzbetreiber dazu verpflichtet werden, auch tatsächlich auf dem flachen Land auszubauen und sich nicht nur die Rosinen rauszupicken. Denn trotz deutlich besserer Reichweiteneigenschaften der neuen Frequenzen wird es immer noch genug Gebiete geben, in denen sich ein wirtschaftlicher Ausbau nicht lohnt.
Auch klar ist, dass selbst auf dem flachen Land mittelfristig ohne Glasfaser kaum etwas geht. Denn wenn die digitale Dividende richtig startet, wird wohl kaum wie bei den Versuchen mit HSDPA ausgebaut, sondern mit der brandneuen LTE-Technik. Die bringt noch höhere Datenraten und somit auch höhere Spektraleffizienz - pro Zeit und Schwingung können also mehr Informationen übertragen werden, das Bit wird günstiger in der Übertragung.Spätestens, wenn dann pro LTE-Basisstation mehrere 100 Megabit/s abgeführt werden müssen, wird das nur noch über Glasfaser möglich sein. Fest steht also: Die digitale Dividende hat das Potenzial, viele ländliche Gebiete mit schnellem Internet zu versorgen. Voraussetzung ist allerdings, dass alles recht schnell geht und dass den Netzbetreibern ordnungspolitische Rahmenbedingungen vorgegeben werden.
T-Mobile
T-Mobile testet in Wittstock/Dosse mit einem TDD-System. In Österreich geht der Konzern noch einen Schritt weiter und betreibt ein Testnetz mit dem UMTS-Nachfolgers LTE.
T-Mobile testet schon seit geraumer Zeit im brandenburgischen Wittstock/Dosse zusammen mit der Medienanstalt Brandenburg. Hier soll vor allem die Abgrenzung zu DVB-T geprüft werden, um spätere gegenseitige Störungen zu verhindern. Im Gegensatz zu den Piloten der anderen Netzbetreiber kommt ein 3G-TD-CDMA-System der Firma IP-Wireless zum Einsatz, mit dem T-Mobile in Tschechien erfolgreich arbeitet.