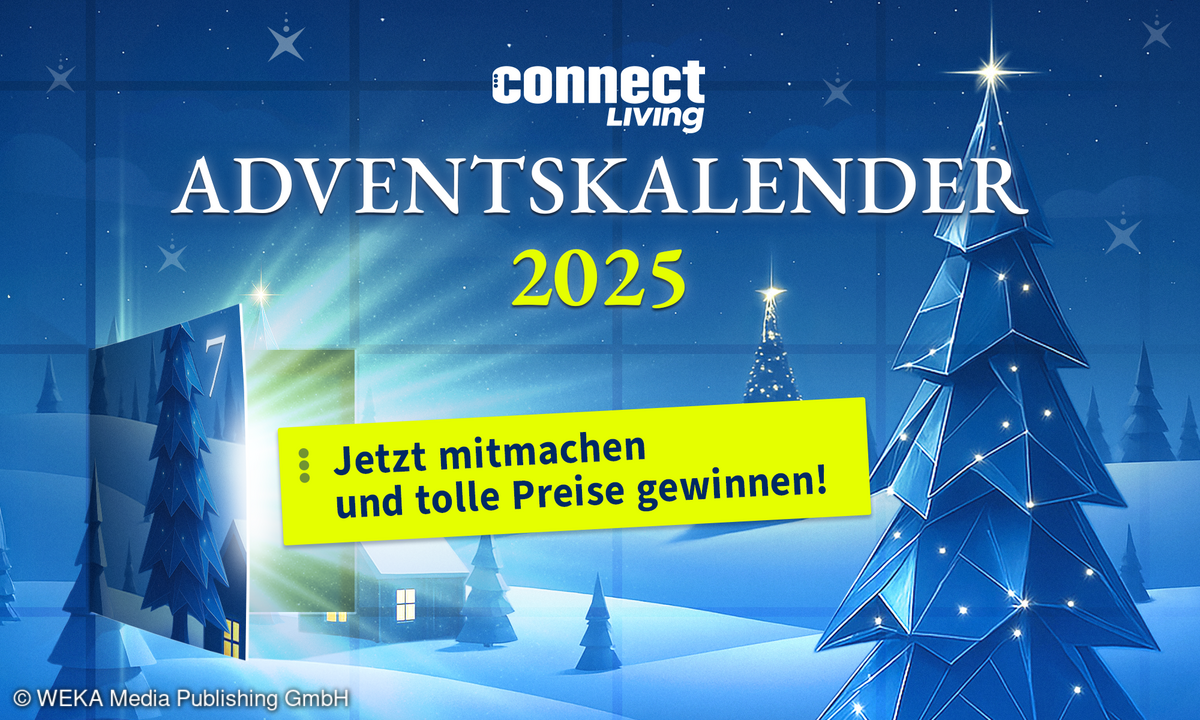Wie entwickelt sich Lasertechnik im Heimkino?
Laserlicht gehört mit zu den faszinierendsten visuellen Eindrücken, die wir kennen. Das rasante, bunte Spiel entdecken wir in Discos, an Wänden, am Himmel - und immer häufiger auch im Heimkino. Wohin geht die Entwicklung?

Bei Science-Fiction-Filmen gehören Laser zur Grundausstattung jeglichen Waffenarsenals. Und ebenso spektakulär wirken sie im echten Leben, wenn die dünnen Strahlen Bilder auf Wolken zeichnen oder bei Rockkonzerten eindrucksvolle Lightshows kreieren. Der feine Unterschied zwischen Fiktion und Real...
Bei Science-Fiction-Filmen gehören Laser zur Grundausstattung jeglichen Waffenarsenals. Und ebenso spektakulär wirken sie im echten Leben, wenn die dünnen Strahlen Bilder auf Wolken zeichnen oder bei Rockkonzerten eindrucksvolle Lightshows kreieren. Der feine Unterschied zwischen Fiktion und Realität: Was im einen Fall trotz beeindruckender Wirkung in handliche Kalibergröße passen soll, benötigt im tatsächlichen Einsatz große, wasser- oder luftgekühlte Armaturen.
Auch im Heimkino trifft man immer öfter auf Lasertechnik. Längst etabliert sind Laser in Blu-ray- und DVD-Playern. Und in der video 12/2011 konnten wir den ersten, im Heimkino einsetzbaren Beamer, den Panasonic PT-AT5000, vorstellen. Wann aber ist Lasertechnik zu aufwendig, und wann hat sie Kugelschreibergröße? Und wie sieht unsere Laserbild-Zukunft aus?

Laser am Himmel
Die deutsche Firma LOBO ist der weltweit führende Anbieter für Show-Laser und inszeniert selbst Laser-Shows. Geschäftsführer ist der Diplom-Ingenieur Lothar Bopp, der sich in Lasertechniken minutiös auskennt. Er macht klar, welche himmelweiten Unterschiede es zwischen den Lasertechniken gibt, und warum der ehemalige deutsche Elektronikhersteller Schneider mit seinem Laser-TV, den LOBO anfangs sogar mitentwickelt hat, gescheitert ist - und heute immer noch scheitern würde.
Der große Traum des Unternehmens aus Türkheim war schon damals, Fernseher und Beamer in kompakter Größe und mit perfekter, nie dagewesener Bildqualität anzubieten. Denn Laser haben eine heiß begehrte Eigenschaft: Sie sind extrem farbrein und liefern daher äußerst klare und tiefe Farben. Videobilder könnten auf diese Weise in einem völlig neuen Glanz erscheinen.
Lothar Bopp führt eindrucksvoll aus, um welche riesige Kostenspanne es bei der Lasertechnik geht. Beamer-Helligkeit wird in ANSI-Lumen gemessen, und professionelle Projektoren schaffen aus dem Stand 5.000. Sie liegen dabei preislich im Tausender- Euro-Bereich. "Schneiders Laser erreichten im Maximum ebenfalls 5.000 Lumen, kosteten aber 500.000 Euro", betont Bopp.

Damit ist bereits eine der großen Herausforderungen der Technologie beschrieben: Nicht die Erzeugung eines Lasers ist heute schwierig, sondern ihn für Videobilder hinreichend lichtstark zu züchten. Und das, obwohl die Blitze aus Lasershow-Kanonen gleißend hell wirken und Bilder sogar auf ferne Wolken malen können.
Doch diese Sparte von Projektoren funktioniert anders. Bilder und Schrift zeichnet ein einzelner, die Farbe wechselnder Laserstrahl hier nur als Kontur. Gelenkt wird er über einen Spiegel, der sich, vom Computer gesteuert, schnell bewegen lässt. Von "High End" spricht man in diesem Fall, wenn die Konturen rund 30-mal pro Sekunde mit 375.000 Bildpunkten gezeichnet werden.
Praxis: Heimkino - Planung und Raumwahl
"Der Schneider-Laser dagegen sollte ein klassisches TV-Bild erzeugen", macht Fachmann Bopp klar. Das bedeutet: Nicht nur Konturen sind zu schreiben, sondern jedes Mal komplett ausgefüllte Bilder, die wie im Videobereich üblich zeilenweise aufgebaut werden. Bei 576 Zeilen ergeben sich daraus fast 600.000 Bildpunkte - und das 50-mal pro Sekunde. Man bewegt sich hier also in ganz anderen Dimensionen. Und da das vorhandene Licht auf viel mehr Bildpunkte verteilt werden muss, reduziert sich die Helligkeit pro Bildpunkt dramatisch.
Selbst bei heutigem Technikstand - zehn Jahre nach Schneider - hält Bopp den Aufwand für ein solches Konzept für viel zu hoch. "Wir haben uns seitdem etwa um den Faktor vier verbessert." Das bedeutet: 5.000 ANSI-Lumen würden ungefähr 125.000 Euro kosten.

Im Kleinen wird's einfacher
Die Projektoren, die Schneider Technologies in den 90ern präsentierte, arbeiteten laut damaligem technischen Stand mit imposanten Laserkanonen und waren für relativ weit entfernte, große Projektionsflächen ausgelegt. Man benötigte dabei hochqualitative Laser mit starker Bündelung für bestens fokussierte Bildpunkte, erklärt der Lobo-Mann.
Für kleine Distanzen, wie sie die Strahlen innerhalb eines Heimkino-Rückprojektors zurücklegen, fallen die Anforderungen an die Bündelung weniger kritisch aus. Zudem muss man den Lasern viel weniger Helligkeit abverlangen. Für solche Bedingungen lassen sich dank des heutigen Know-hows inzwischen deutlich kleinere Laser bauen. So gelangte man von den großen, aufwendigen Gas-Ionen-Lasern mit wasser- oder luftgekühlten Glaskolben zur kompakten Festkörper-DPSS-Technik (Diode Pumped Solid State, auf Deutsch: Dioden-gepumpter Festkörper- Laser).
Der Laser generiert sich dabei aus dem Teamwork von nicht sichtbarem Infrarotlicht als Energiequelle und einem Kristall. Das Infrarotlicht wird in den Kristall hineingelenkt ("gepumpt"), der durch die zugeführte Energie zu leuchten beginnt. Zwischen zwei Spiegeln eingeklemmt, wechselt das Licht im Kristall hin und her, wobei es sich stetig verstärkt. Zudem zwingt man ihm eine bestimmte Leuchtrichtung auf, wodurch es sich immer weiter bündelt.

Hat es die beabsichtigt hohe Intensität erreicht, tritt es durch einen der beiden Spiegel als richtungsstabiler, stark gebündelter Laserstrahl aus. Daher rührt der Name "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation", was in etwa "Lichtverstärkung durch anregende Strahlung" bedeutet.
Nach wie vor experimentieren und tricksen die Forscher dabei: Die Zusammensetzung der eigens gezüchteten Kristalle, das Zusammenspiel von Infrarotlicht und Kristall sowie das Verändern von Licht-Wellenlängen sind dabei die derzeitigen Spielfelder.
Doch selbst bei dieser Technik ist die Lichtausbeute im Verhältnis zum Kostenaufwand noch zu gering für einen breiten Einsatz bei Heimkino-Beamern - zumindest zum jetzigen Zeitpunkt.
Kaufberatung: Die besten Blu-ray-Player
Anders ist das bei den "Dioden-Lasern" als klar günstigere Variante. Hier wird statt des Infrarotlichts als Energiequelle ein einfacher, elektrischer Strom "gepumpt", der durch den Kristall hindurchfließt. Das entstehende Laserlicht ist zwar viel weniger zu bündeln und heller als beim DPSS-Ansatz. Doch die Möglichkeiten reichen für Laserpointer, Blu-ray- Player und sogar Beamer.

Mitsubishi lässt Schneiders Traum wahr werden
Dank Laserdioden kamen in den 90er-Jahren rot strahlende Laserpointer auf. Den schwieriger zu kreierenden blauen Laser, der uns die Blu-ray-Technik bescherte, lernten wir in den frühen 2000ern kennen. Grün ist nach wie vor ein Problem in der günstigen Kompaktklasse und muss durch Energie schluckende Manipulation der Lichtwellenlänge erzeugt werden. Und was wurde aus Schneiders Traum vom Laserfernseher?
Der japanische Hersteller Mitsubishi hat ihn in abgewandelter Form beim Rückprojektions-TV LaserVue verwirklicht. Die Grafik zeigt das Prinzip. Anders als bei Schneider zeichnen die Laser die Bilder allerdings nicht Zeile für Zeile auf die Projektionsfläche.

Stattdessen ist die bekannte DLP-Technik von Texas Instruments dazwischen geschaltet, die die einzelnen Bildpunkte generiert. Trotz einmaliger Technik ist der LaserVue-TV in Europa nicht erhältlich, weil Mitsubishi für den dicken, rund 4.000 US-Dollar kostenden Rückprojektor hierzulande keine Marktchancen mehr sieht.
Ein weiterer Vertreter für reine Laserlicht-Konzepte ist ein High-End-Beamer des US-amerikanischen Herstellers RED. Mit 4K-Bildpunktzahl und 3D-Fertigkeit soll sein Preis unter 10.000 US-Dollar liegen.

Variante Hybrid-Beamer
Auf dem Laser-Beamer-Markt sind gegenwärtig auch Mischformen zu finden, bei denen die überragende Farbqualität des Lasers nicht zum Tragen kommt. Wie beim Hybrid-Auto kommen zwei unterschiedliche Antriebstechniken gleichzeitig zum Einsatz: Laserlicht und LED. Begehrt sind die Techniken gleichermaßen, weil sie die Grundfarben Rot, Grün und Blau ähnlich rein darstellen. Zudem besitzen beide Lichtquellen eine deutlich längere Lebenszeit als herkömmliche UHP-Lampen.
Doch für normale Beamer reicht die Helligkeit der Dioden-Laser und der LEDs nicht aus. Man könnte sie zwar hochtunen, doch dann müsste man sie lautstark kühlen.
Kaufberatung: LED/Laser-DLP-Projektoren im Test
Casio hatte als erster Hersteller eine Lösung parat. Hier kommen eigentlich sogar drei Leuchttechniken zum Einsatz. Der Laser regt dabei eine Phosphorschicht zum Leuchten an, die sehr helles, grünes Licht erzeugt. Hybrid-Technik bügelt also den Helligkeitsmangel aus und macht die Beamer langlebiger, opfert jedoch die ursprünglich hohe Farbqualität.

Blauer und roter Laser
Die Laserdioden in Blu-ray- und DVD-Playern müssen sich nicht mit Helligkeitsproblemen herumschlagen. Ihre Leistung ist bereits heute ausreichend. Obgleich die Lichtbündelung von Laserdioden nicht optimal ausfällt, reicht sie für die Discs aus. Dank des geringen Durchmessers des Strahls lassen sich Daten auf engstem Raum exakt ablesen.
Diese Fertigkeit wurde von der Entwicklung von der DVD zur Blu-ray weiter perfektioniert. Der blaue Laser hat eine geringere Lichtwellenlänge als der rote bei der DVD-Technik. Aus physikalischen Gründen kann man dieses kurzwelligere Licht noch stärker bündeln, was eine höhere Datendichte auf der Disc ermöglicht. So passen High-Definition-Filme auf eine einzelne Scheibe.
Hier sind Verbesserungen der Lasertechnik also vorerst nicht vonnöten. Für die Beamer wird sich bald etwas Neues ergeben, weiß Fachmann Bopp. Mehr Leistung zu geringeren Kosten lautet die Stoßrichtung. Handliche Laserwaffen dagegen bleiben sicher noch lange Fantasie - zum Glück.